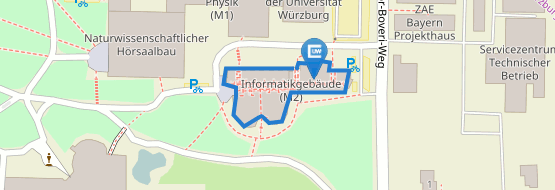Informationen zum Staatsexamen
Informationen zum Staatsexamen Softwaretechnik
Auf dieser Seite versuchen wir, Ihnen inhaltliche Informationen zum Staatsexamen Softwaretechnik (Informatik) zusammenzustellen. Diese Seite ist dabei als Hilfestellung für Studenten und Aufgabenersteller, zu denen auch Professoren an der Universität Würzburg gehören, gedacht.
Die untenstehenden Informationen stellen dennoch nur die Meinung der Seitenautoren dar. Keinesfalls sollten untenstehende Informationen als offiziell oder verbindlich betrachtet werden! Die Auswahl geeigneter Inhalte ist alleinige Sache der Aufgabenersteller. Diese haben weder alle Kenntnis von diesem Text, noch sind sie in irgendeiner Weise an ihn gebunden. Dennoch hoffen wir, durch diese Seite in gewisser Weise zur Vergleichbarkeit verschiedener Staatsexamensprüfungen beizutragen.
Studierende des Lehramts Gymnasium schreiben die vertieften Prüfungen, andere Lehrämter die üblicherweise etwas einfacheren nicht-vertieften Prüfungen.
Themenmatrix und alte Aufgabenstellungen
In diesem Abschnitt finden Sie alte Aufgabenstellungen und eine Einordnung der Aufgaben zu bestimmten Themenblöcken. Diese werde im nächsten Abschnitt detaillierter beschrieben.
Softwaretechnik (vertieft)
| Examen | Thema | Klassen-diagramm | UML-Diagramme | Program-mierung | Testen | Formale Verifikation | Entwurfs-muster | Wissens-fragen | Projekt-ablauf | Petrinetze | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2012 | T1 | 2b | 2a, 3 | 4 | 1 | ||||||
| T2 | 4b | 4a, 5c-d | 5a-b | 1 | 3 | 2 | |||||
| H2012 | T1 | 1a | 1b | 2 | |||||||
| T2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| F2013 | T1 | 1 | 2 | ||||||||
| T2 | 2, 3a | 4 | 3b, 5b | 1a, 5a | 1b-c | ||||||
| H2013 | T1 | 4 | 3 | 1b | 1a | 2 | |||||
| T2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| F2014 | T1 | 1a | 1b | 1c | |||||||
| T2 | 2 | 4a-b | 1 | 3 | |||||||
| H2014 | T1 | 1, 2 | 4 | 3 | |||||||
| T2 | 2b | 5 | 3 | 1, 4 | 2a | ||||||
| F2015 | T1 | 1 | 2 | 3a | 3b-c | ||||||
| T2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| H2015 | T1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| T2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| F2016 | T1 | 1a | 1b | 2c | 2a-b | ||||||
| T2 | 2 | 4a | 1 | 3, 4b-f | |||||||
| H2016 | T1 | 2b | 2a | 2c | 3 | 4 | 1 | ||||
| T2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| F2017 | T1 | 5 | 3, 4a | 4b | 1 | 2 | |||||
| T2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| H2017 | T1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| T2 | 2a | 2b | 4 | 3 | 1 | ||||||
| F2018 | T1 | 3 | 1, 2 | ||||||||
| T2 | 1a-b | 1c-d, 3 | 2d | 4 | 2a-c | ||||||
| H2018 | T1 | 2a, 3c | 1, 3b, 2c | 4 | 5 | 2b | 3a | ||||
| T2 | 3 | 5 | 6, 8 | 4 | 7, 10 | 1, 2, 9 |
Softwaretechnik (nichtvertieft)
| Examen | Thema | Klassen-diagramm | UML-Diagramme | Program-mierung | Testen | Formale Verifikation | Entwurfs-muster | Wissens-fragen | Projekt-ablauf | Petrinetze | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2012 | T1 | 3a | 3b-c | 3d, 4 | 2 | 1 | |||||
| T2 | 1 | 2 | |||||||||
| H2012 | T1 | ||||||||||
| T2 | |||||||||||
| F2013 | T1 | 1a | 1b | 2 | |||||||
| T2 | 2 | 1b | 1a | ||||||||
| H2013 | T1 | ||||||||||
| T2 | |||||||||||
| F2014 | T1 | ||||||||||
| T2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| H2014 | T1 | 1 | 2 | ||||||||
| T2 | 3b | 3a, 3c-d | 1 | 2 | |||||||
| F2015 | T1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| T2 | 3a | 3b | 3c | 1 | 2 | ||||||
| H2015 | T1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| T2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| F2016 | T1 | 2a | 3 | 2b | 1 | ||||||
| T2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| H2016 | T1 | 3a-b | 4 | 2a, 3c | 2b | 1 | |||||
| T2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| F2017 | T1 | 3 | 2 | 4, 6 | 1 | 5 | |||||
| T2 | 4b | 4a | 4c | 2 | 3 | 1 | |||||
| H2017 | T1 | 2a | 2b | 4 | 1 | 3 | |||||
| T2 | 2b | 3 | 1 | 2a | |||||||
| F2018 | T1 | ||||||||||
| T2 | |||||||||||
| H2018 | T1 | 1 | 3 | 2b-c | 4 | 2a | |||||
| T2 | 3, 5 | 6, 7, 8, 9, 10 | 4 | 1, 2 |
Inhalte
In diesem Abschnitt wollen wir Ihnen einen Überblick über typische Aufgaben und Inhalte der einzelnen Aufgaben geben. Als allgemeiner Trend kann beobachtet werden, dass das Staatsexamen in SWT umfangreicher wird und zumeist aus mehr, dafür kürzeren Aufgaben besteht. Insbesondere ist es deshalb schwierig, eine abschließende Aufzählung des Stoffes anzugeben. Untenstehende Auswahl soll einen ersten Überblick verschaffen. Dass ein Aspekt unten nicht aufgeführt ist heißt aber keinesfalls, dass er noch nicht abgeprüft wurde oder künftig nicht abgeprüft wird!
Klassendiagramm
| Häufigkeit: | Kanonisch |
|---|---|
| Inhalte: |
|
| Schwierigkeiten: |
|
| Bsp.-Aufgabe: | Für ein [...] System an einer [...] soll ein [...]-Programm entworfen werden. Entwerfen sie ein UML-Klassendiagramm für folgendes Szenario: [...] |
Sonstige UML-Diagramme
| Häufigkeit: | Gelegentlich, viele unterschiedliche Ausprägungen |
|---|---|
| Inhalte: |
|
| Schwierigkeiten: |
|
Programmierung
| Häufigkeit: | Meistens, Art und Umfang verschieden |
|---|---|
| Inhalte: |
|
| Schwierigkeiten: |
|
| Entwicklung des Aufgabentyps: | Zu Beginn war die Umsetzung kleiner- bis mittelgroßer Programme zentraler Bestandteil des SWT-Examens. Der Aufgabentyp ist mittlerweile seltener geworden und zielt nun stärker auf theoretische, für alle Programmiersprachen gültige Kenntnisse ab. Wenn Code gefordert ist, so beschränkt er sichin neueren Examen zumeistens auf wenige Zeilen bis etwa eine Seite. |
Testen und Fehler
| Häufigkeit: | Häufig, insbesondere in letzter Zeit |
|---|---|
| Inhalte: |
|
| Schwierigkeiten: | Das Themengebiet ist sehr umfangreich und lässt sich nur schwer eingrenzen. Sehr häufig werden einfache Verständnisfragen gestellt, auf die sich jedoch nicht gezielt lernen lässt. |
| Literatur: | Hoffmann: Software-Qualität (ISBN 978-3540763222, als E-Book im Katalog der Universität Würzburg vorhanden) |
Formale Verifikation
| Häufigkeit: | Gelegentlich, künftig hoffentlich seltener |
|---|---|
| Inhalte: |
|
| Schwierigkeiten: |
|
| Literatur: | Hoffmann: Software-Qualität (ISBN 978-3540763222, als E-Book im Katalog der Universität Würzburg vorhanden) |
Entwurfsmuster
| Häufigkeit: | Gelegentlich |
|---|---|
| Inhalte: |
|
| Schwierigkeiten: | Die Fragestellung zielt manchmal darauf ab, Beispiele an Mustern zu nennen, manchmal wird aber auch die Nennung der drei Kategorien gefordert. Dies ist häufig nur durch exaktes Lesen der Aufgabenstellung erkenntlich. |